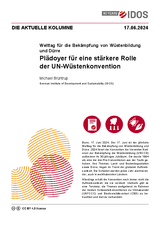Die aktuelle Kolumne
Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre
Plädoyer für eine stärkere Rolle der UN-Wüstenkonvention
Brüntrup, MichaelDie aktuelle Kolumne (2024)
Bonn: German Institute of Development and Sustainability (IDOS), Die aktuelle Kolumne vom 17.06.2024
Bonn, 17. Juni 2024. Der 17. Juni ist der jährliche Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre. 2024 feiert die Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) außerdem ihr 30-jähriges Jubiläum. Sie wurde 1994 als eine der drei Rio-Konventionen aus der Taufe gehoben. Ihre Themen, Land- und Bodendegradation sowie Dürre, liegen im Trend der globalen Aufmerksamkeit. Die Schäden werden jedes Jahr alarmierender, auch in wohlhabenden Ländern.
Allerdings erhält die Konvention noch immer nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Vielmehr gibt es eine Tendenz, die Themen weitgehend im Rahmen der beiden Schwesterkonventionen zu Klimawandel (UNFCCC) und Biodiversitätsverlust (CBD) zu betrachten und dort zu verhandeln.
Das ist einerseits begrüßenswert, denn diese beiden Konventionen sind Zugpferde der internationalen Umweltdebatten. Aber es wird der UNCCD nicht gerecht und kann dazu führen, dass ihre Themen nicht richtig betrachtet und damit effektiv behandelt werden. Denn die UNCCD hat einen besonders ausgewogenen Blick auf die beiden Pole in Umweltdebatten: auf der einen Seite der Schutz der Umwelt und auf der anderen Seite die Nutzung der natürlichen Ressource Boden. Die richtige Balance zu treffen ist gerade in diesem Fall besonders wichtig, denn von Land und Boden lebt die größte Gruppe der Armen und Verletzlichen: Ca. 500 Millionen Kleinbauernfamilien mit über 2 Milliarden Menschen in den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.
Die UNCCD wurde vor 30 Jahren als afrikanische Konvention angesehen. Verwüstung galt damals als die wichtigste Umweltherausforderung des Kontinents. Schon daraus lässt sich erklären, dass der Aspekt der nachhaltigen Nutzung und Wiederherstellung der Ressource Boden besonderes Gewicht hatte. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern hatten und haben in der Regel keine Alternative zur Landwirtschaft. Die meisten reichen Länder traten der Konvention zwar bei, um die betroffenen Länder zu unterstützen, definierten sich selber aber als „nicht betroffen“.
Die Konzentration auf Afrika und dabei auch noch auf trockene Standorte, die als besonders anfällig für Verwüstung gelten, hatte zwar den Vorteil einer großen Identifikation der afrikanischen Staaten mit „ihrer“ Konvention, jedoch erfüllte sich die Hoffnung auf besondere Finanzhilfen im Kampf gegen die Verwüstung nicht. So waren bspw. im Zeitraum 2014-2016 nur knapp 6% der öffentlichen Entwicklungsgelder (ODA) für die Umsetzung der Rio-Konventionen für Desertifikation markiert, der große Rest für Klimawandel und Biodiversität. Diese sehen oft eher den Schutz der Ressourcen als Priorität und weniger ihre Nutzung, die nur ein „co-benefit“ ist.
Die besondere Perspektive der UNCCD auf Schutz und gleichzeitig Nutzung von Ressourcen zeigt sich gut im Konzept der Landdegradationsneutralität oder Land Degradation Neutrality (Land Degradation Neutrality, LDN). Dieses erkennt an, dass Bodennutzung nötig ist und zu Degradierung führen kann, fordert aber eine Kompensation durch Verbesserung der Bodenqualität in gleichem Ausmaß und auf vergleichbaren Standorten. Die Erfahrung mit dem LDN-Konzept lehrt auch, dass es für die UNCCD und ihre besondere Zielgruppe sinnvoll ist, von der geographischen engen Zielorientierung wegzukommen hin zu einem globalen Anspruch. Denn es wurde mittlerweile von über 140 Ländern bestätigt, auch von vielen reichen Ländern, die sich unter dem Desertifikationsziel als „nicht betroffen“ definiert hatten. Bodenschutz wird mittlerweile als globale Herausforderung anerkannt, er ist im Nachhaltigen Entwicklungsziel 15 (Leben an Land) verankert, und die UNCCD wurde „Wächter“ (Custodian Agency) des entsprechenden Indikators. Damit hat die Konvention erstmals globale Bedeutung, was ihr einen enormen Aufschwung an Bedeutung und Aufmerksamkeit bescherte und die Finanzierung des Themas durch internationale Fonds wie die Globale Umweltfazilität deutlich erhöhte.
Was heißt das alles für die Zukunft der UNCCD und welche Rolle kann Deutschland spielen? Für die Kernthemen Land/Boden und Dürreresilienz sollte die Konvention gestärkt werden, um hier speziell die Vereinbarkeit von Schutz und Nutzung zu fördern. Deutschland hat dafür schon viel geleistet, könnte aber noch mehr tun. Es könnte zum Beispiel durch die Definition Deutschlands und Europas als „betroffene“ und nicht nur „unterstützende“ Mitglieder die Basis der Konvention verbreitern. Es könnte die Globalisierung der UNCCD fördern, indem es sie in andere globale Foren wie globale Umwelt- oder Entwicklungsfinanzierungs-Programme einbezieht. Es könnte eine höhere Kernfinanzierung der UNCCD zusagen. Es könnte eigene bilaterale Programme vermehrt in formale Kooperationen mit UNCCD wie in der „Great Green Wall Initiative“ einbringen. Deutschland kann sich dadurch gleichzeitig Einfluss in einem globalen Forum sichern, dass angesichts der zunehmenden Problematik und der wachsenden internationalen Aufmerksamkeit seine große Zukunft noch vor sich hat, noch viel Flexibilität besitzt und noch nicht so stark wie die anderen Rio-Konventionen in Verhandlungs-Marathons erstarrt ist.